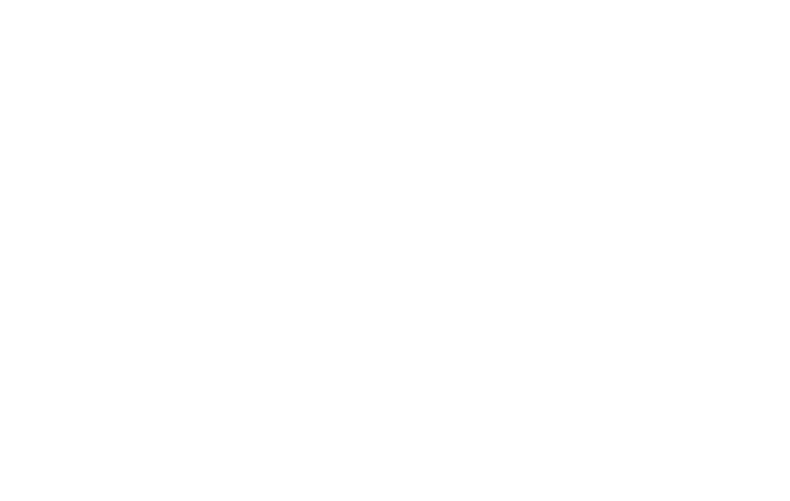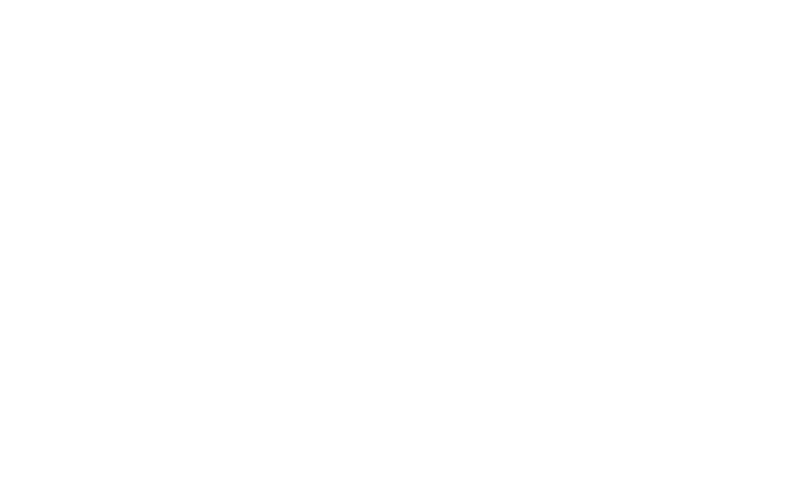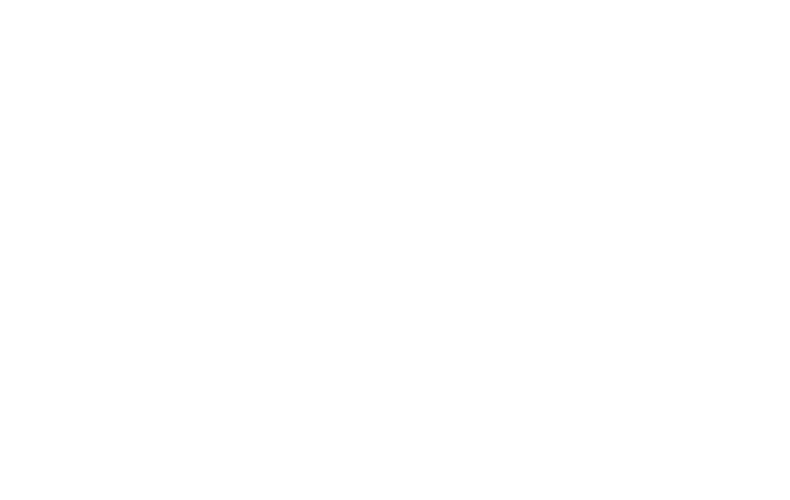„Wasser kennt keine Grenzen“
Dritter Wasserkongress Berlin-Brandenburg-Sachsen 2025
Text: Philipp Zettl | Referent Politische Grundsatzfragen
In Deutschland häufen sich die ersten Trockenheitsmeldungen der Saison. Der richtige Zeitpunkt also, um mit rund 250 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik beim dritten Wasserkongress Berlin-Brandenburg-Sachsen über konkrete Strategien und technische Lösungen für eine krisenfeste Wasserversorgung zu diskutieren – regional, vernetzt und zukunftsorientiert. Gemeinsam organisiert von den Industrie- und Handelskammern Berlin, Brandenburg und Sachsen, den Landesgruppen Berlin-Brandenburg und Sachsen des Verband Kommunaler Unternehmen und dem VBKI, machte die Veranstaltung deutlich, wie eng Klimaanpassung, Strukturwandel und wirtschaftliche Entwicklung miteinander verflochten sind – und dass Wasserpolitik längst auch Wirtschaftspolitik ist.
„Wir müssen lernen, gemeinsam zu denken und zu handeln“, mit dieser Feststellung leitete VBKI-Geschäftsführerin Ute Weiland die Diskussion ein. Denn der Handlungsdruck ist hoch – der diesjährige März war mit 2,41 Grad über dem langjährigen Mittel nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus der wärmste März seit Aufzeichnungsbeginn in Europa. Dabei wird laut IHK-Berlin Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner immer klarer: „Wasser ist eine Mangelressource.“

Alle Fotos: Copyright Konstantin Gastmann


Koordination statt Konkurrenz war dementsprechend eines der wichtigsten Themen des Tages. Referatsleiterin Frauke Bathe aus der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin, Anke Herrmann, Abteilungsleiterin im Brandenburger Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, und Birgit Lange, Referatsleiterin im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft berichteten, wie die drei Bundesländer gemeinsam an Wasserstrategien und Strukturen arbeiten. Was die drei überraschte: Wie wenig das Thema Wasser zu Beginn im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz verankert war. Durch regelmäßige Austausche haben sich dies aber deutlich verbessert. Dass es die Wasserversorgung sogar in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung geschafft habe, stimme positiv, so Anke Herrmann. Die größte aktuelle Herausforderung sei es, die Datenlage zu verbessern und gleichzeitig schon erste Maßnahmen umzusetzen, berichtete Bathe.
Wie eine regionale Zusammenarbeit funktionieren kann, zeigte Christoph Maschek, Geschäftsführer des Wasserverband Lausitz, am Beispiel des länderübergreifenden Trinkwasserverbunds im Lausitzer Revier. Sechs kommunale Versorger aus Sachsen und Brandenburg haben sich seit 2019 zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Flexibilität, Versorgungssicherheit und Zukunftsfähigkeit. Ein technisches Gesamtkonzept mit 67 Maßnahmen – darunter Speichererweiterungen, neue Fernleitungen und eine Ausweitung der Wasserwerkskapazitäten um 20 Prozent – wurde in kürzester Zeit entwickelt. Die Grundlage: klare Daten, pragmatische Zusammenarbeit und politischer Rückenwind durch den Kohleausstieg


Doch langwierige Genehmigungsverfahren, komplexe Zuständigkeiten und ausufernde Abstimmungsprozesse behindern vielerorts den Fortschritt. Tesla etwa verhandelte während des Firmenbaus laut Alexander Riederer von Paar, Manger Public Policy & Business Development, mit 16 Kommunen gleichzeitig – eine Hürde, die sich nicht jedes Unternehmen leisten kann. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien wurde deutlich: die technischen Möglichkeiten sind vorhanden – doch der regulatorische Rahmen hinkt hinterher. Martin Richter vom Wasserkraftverband Mitteldeutschland machte deutlich, dass in Sachsen allein 85 bis 120 Wasserkraftwerke reaktiviert werden könnten. Genehmigungen ziehen sich jedoch teils über Jahre. Gleichzeitig böte die Kombination aus Wasserkraft und Aquathermie eine ressourcenschonende Option für Wärmeversorgung in Städten.
Dr. Christoph Schulte vom Umweltbundesamt zeigte in seinem Impuls „Wasser ohne Ende?“ auf, dass Deutschland zwar weniger Wasser entnimmt als noch vor 30 Jahren, das Dargebot aber gleichzeitig sinkt. Besonders kritisch sei die Situation in Regionen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Seine Forderung: Leitlinien zur Priorisierung bei Nutzungskonflikten müssen umgesetzt, Datenlücken geschlossen und die Wiederverwendung von Wasser gefördert werden. Auch die Stadt könne einen Beitrag leisten und mittels Schwammstadt-Konzepten zur „wassersensiblen Stadt“ weiterentwickelt werden. Die größte Herausforderung hierbei laut Frank Bruckmann, Finanzvorstand der Berliner Wasserbetriebe: der Umbau bestehender Infrastruktur. Im Neubau sei man in Berlin, unter anderem dank der Berliner Regenwasseragentur, die viel Beratungsarbeit übernehmen, gut dabei.
Als ein Positivbeispiel nannte Berlins Umweltsenatorin Ute Bonde den schwammstadtgerechten Umbau des Gendarmenmarkts. Doch zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung sahen sowohl die Senatorin als auch Brandenburgs Umweltstaatssekretär den Bund in der Verantwortung. Letzterer nannte auch eine Reform des Naturschutzes als wichtiges Ziel – dieser sei oft verantwortlich für die langen Genehmigungsverfahren. Schnellere Genehmigungsverfahren und eine langfristig gesicherte Wasserversorgung nannte Heiko Zien, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Heidenau des Verbands Nord- und Ostdeutscher Papierfabriken e.V., als wichtigste Forderungen der Wirtschaft in Bezug auf Wasser.
Der Wasserkongress 2025 zeigte deutlich: Wasserpolitik kann nur erfolgreich sein, wenn sie ressort- und länderübergreifend gedacht wird. Ob es um Speicher, Stadtentwicklung oder Unternehmensansiedlungen geht – entscheidend ist die Zusammenarbeit. Oder wie es Berliner Wasserbetriebe-Vorstand Frank Bruckmann formulierte: „Der Wassertropfen macht an keiner Landesgrenze halt – wir sollten es auch nicht tun.“
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
Gemeinsame Erklärung
Berliner Wirtschaft steht hinter Olympiabewerbung
Exzellenz, Vernetzung und Mut zur Veränderung
Gesundheitshauptstadt Berlin: Expertenrunde diskutiert Wege, Hürden und Chancen
Warschau – Partnerstadt und Vorbild für Berlin
Meinungsbeitrag von Kirsten Giering und Johannes von Thadden