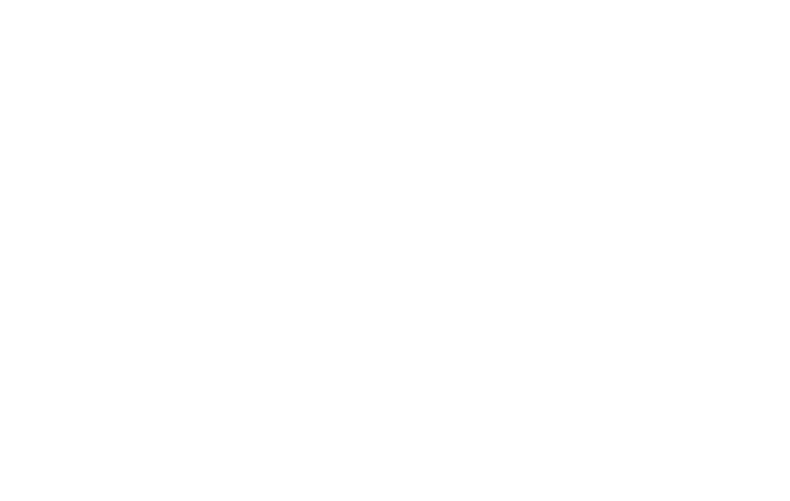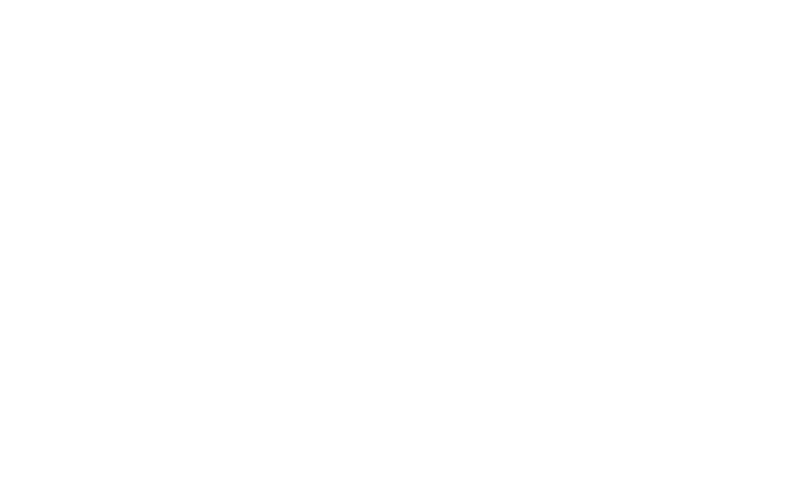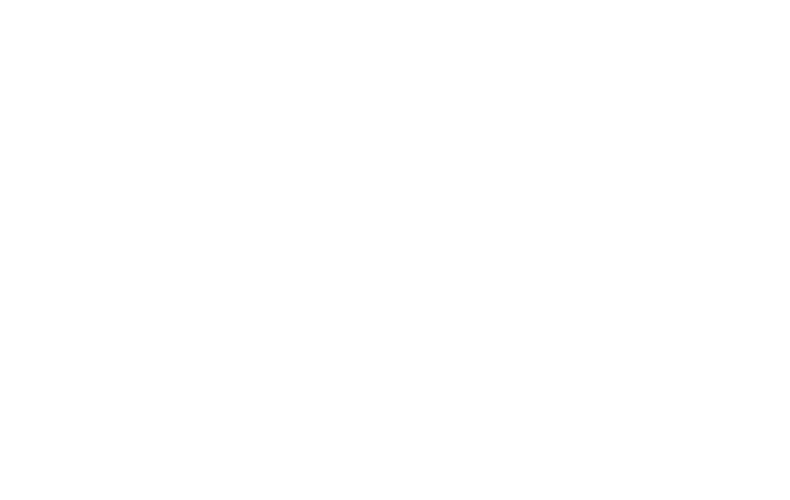Jetzt aber Prompt!
Künstliche Intelligenz: Wo steht Berlin im weltweiten Standortwettbewerb?
Text: Philipp Zettl | Referent Politische Grundsatzfragen
KI-getriebene Anwendungen sind im Begriff, unser Leben und Arbeiten von Grund auf zu verändern. Wo steht Berlin mit seiner herausragenden Wissenschaftslandschaft und seiner vibrierenden Start-up-Szene im weltweiten Wettbewerb? Was sind die “Assets” des Standorts, wo liegen seine Schwächen? Eine vom Tech-Journalisten Nikolaus Röttger moderierte Expertenrunde ist diesen und weiteren Fragen nachgegangen. Das Ergebnis: Im internationalen Rennen liegt unsere Region nicht so weit vorne, wie viele gerne glauben. Aber es gibt Hoffnung.
Ein wichtiges Pfund, mit dem man in Berlin in Sachen KI wuchern kann, ist das Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data, kurz: BIFOLD. Allerdings kann dieses im internationalen “War of Talents” ziemlich erfolgreiche KI-Grundlagenforschungszentrum seine Potenziale nicht gänzlich ausschöpfen, berichtete Dr. Jack Thoms, Managing Director des Instituts. Wegen des immensen Sanierungsstaus im Berliner Hochschulbereich und den vielen geschlossenen Gebäuden sitzen die Forscher nicht an einem gemeinsamen Ort, sondern über ganz Berlin verteilt – teilweise sogar dauerhaft im Homeoffice.
Und wie verhält es sich mit den Ausgründungen? Viel hängt vom Bewertungsmaßstab ab: Sich dafür zu feiern, mehr KI-Startups als München zu haben, sei fragwürdig – schließlich ist die bayerische Hauptstadt nur halb so groß wie Berlin. Berlin müsse sich eigentlich mit London und Paris vergleichen – beides Städte, die kurz davor seien, Berlin in Sachen KI abzuhängen, mahnte Dr. Thoms. In der Berliner Politik fehle ihm die ernsthafte Beschäftigung mit der Bedeutung von KI für die Stadt und die Wirtschaft – nicht nur finanziell – bedauerte Thoms. In anderen Bundesländern sei KI Chefsache: „Da braucht man sich nicht wundern, dass die KI-Unicorns nicht aus Berlin kommen!“




Noch einen Schritt weiter ging Prof. Dr. Marc Drüner, Gründer und CEO des KI-Startups eduBITES: „Das Rennen der KI-Deeptechs haben wir bereits verloren, Deutschland ist zu teuer und es fehlt eine ordentliche Förderung.“ Dr. Florian Schütz, Geschäftsführer des KI Park, sekundierte: Auf Grund strenger Datenschutzrichtlinien sei ganz Europa und Deutschland im Speziellen wahnsinnig schlecht darin, KI mit Endnutzerdaten zu füttern und zu trainieren. Das sei ein riesiger Standortnachteil. Aber es gebe Hoffnung: Deutschland habe im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern immer noch eine starke Industrie, dazu Spitzen-Wissenschaft und eine lebendinge Startupszene: „Wenn wir den Fokus auf die Entwicklung von Industrie-KI legen, gefüttert mit Industriedaten statt menschlichen Daten, haben wir weiterhin die Chance, ganz vorne mitzuspielen.“
Wie man in Unternehmen KI einführen kann, berichteten Joachim Spitzley. Die Handwerksbranche sei ein sehr traditionelles Geschäft, sagte der Vorstandsvorsitzende der bito AG: „Im Gespräch mit Geschäftspartnern aus der Branche werde ich häufiger gefragt: ‘Kann ich KI nicht genauso aussitzen wie die Blockchain Technologie und andere Neuentwicklungen? ’“ Er wolle seine Mitarbeiter, sein wichtigstes Kapital, von administrativen Arbeiten befreien, das gehe nur mit KI. Sein Weg, um die Vorurteile seiner Belegschaft abzubauen: Viel persönliche Überzeugungsarbeit und der Rückgriff auf externe Experten, die sehr plastisch die Vorteiler der KI erläutert hätten.
Bei der Einführung von KI im Unternehmen gibt es einiges zu beachten. Die richtigen Usecases wollen definiert, der Ressourceneinsatz optimal gesteuert werden. Ebenfalls wichtig sei es, sensibel für die mögliche Voreingenommenheit von KI-Anwendungen zu bleiben, sagte Anette von Wedel. KI ist laut der CEO von female Vision schließlich menschengemacht: Alles, was in der realen Welt passiere, finde auch in der KI seinen Niederschlag, etwa Rassismus oder andere Formen der Diskriminierung. Dafür gäbe es viele Einfallstore: Zum Beispiel kann eine Unterrepräsentation von Daten von Frauen oder Minderheitengruppen prädiktive KI-Algorithmen im Gesundheitswesen verzerren oder die kognitive Voreingenommenheit, wenn Menschen durch Ihre Eingaben unbewusst ihre Vorurteile mit in die KI geben und damit den Algorithmus verzerren. Gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, habe Female Vision den KIDD-Prozess entwickelt, der solche Bias verhindern soll. Das Ergebnis: Der Anfang sei immer mühsam, am Ende steige aber die Qualität der KI und das Vertrauen der Mitarbeitenden in die KI.
Abschließend empfahl Prof. Drüner in drastischen Worten allen anwesenden Unternehmern, sich intensiv mit Künstlicher Intelligenz zu befassen: „Es wird ein Blutbad geben durch KI. Schauen Sie sich Ihre Prozesse an, Ihre Konkurrenten werden es auch tun.“
Weitere Hintergründe zu KI im Unternehmenskontext finden Sie im aktuellen VBKI SPIEGEL – hier geht’s zur Online-Ausgabe.
Herzlichen Dank an das Team von VBKI-Digital für die Vorbereitung der Veranstaltung. Sie wollen auch mitmachen? Dann melden Sie sich bei Philipp Zettl
Impressionen
Zur Bildergalerie: Bitte hier klicken>
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
Mehr Wirkung, weniger Bürokratie
VBKI-Diskussionspapier: Drei Vorschläge für eine zukunftsfähige Hochschullandschaft
„Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem“
Business Breakfast: Vonovia-Chef Rolf Buch zu Gast beim VBKI
Politik hautnah erleben
VBKI Young Professionals zu Gast im Schloss Bellevue